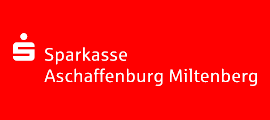
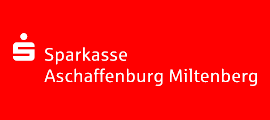
Nachricht
*
CDU-Chef Merz zieht sogar Parallele zu 1933
*
Appell an mögliche Koalitionspartner
*
Im Falle eines Wahlsiegs steht Union unter enormen Erfolgsdruck
*
Politologe: Union macht Demokratie an sich zum Wahlkampfthema
| - von Andreas Rinke |
| Berlin, 22. Jan (Reuters) - Warnungen vor Wahlerfolgen |
| der AfD gibt es seit langem. Aber am Sonntag holte Friedrich |
| Merz ganz weit aus: Der Unions-Kanzlerkandidat warnte nicht nur |
| vor einem Wahlsieg der Rechtspopulisten 2029 in Deutschland. |
| "Ich sage es, wie ich es denke: Die nächste Bundestagswahl ist |
| dann 2033. Und einmal 33 reicht für Deutschland", fügte er in |
| Anspielung auf die Machtübernahme der Nazis 1933 hinzu. |
Dies ist die bisher düsterste offene Warnung, dass eine rechtspopulistische Partei auch in Deutschland entscheidend an Einfluss gewinnen könnte. Aber in den vergangenen Wochen sprach fast ein Dutzend Politikerinnen und Politiker von der Union - und vereinzelt auch von der SPD - in vertraulichen Gesprächen warnend davon, dass die Parteien der politischen Mitte nur noch "einen letzten Schuss" hätten. In der nächsten Legislaturperiode müssten zentrale Probleme unbedingt gelöst werden. Das hat verschiedene Gründe.
DER ÖSTERREICH-SCHOCK
Die Entwicklung in Österreich hat mehr Spuren hinterlassen, als Politiker in Berlin anfangs realisierten. Zwar wird überall betont, dass Deutschland nicht mit Österreich zu vergleichen sei: In dem Alpenland ist die rechtspopulistische FPÖ tatsächlich erstmals schon 1983 an Regierungen beteiligt gewesen. Eine "Brandmauer" gegenüber der Rechtsaußen-Partei wie in Deutschland gibt es dort schon lange nicht mehr. Und nicht nur die konservative ÖVP, auch die SPÖ regierte bereits mit ihr.
"Aber es gab einen FPÖ-Schock in Deutschland", sagt Oliver Lembcke, Politologe an der Universität Bochum, zu Reuters. Sichtlich fassungslos beobachten Unionspolitiker und Sozialdemokraten derzeit im nördlichen Nachbarland, dass ÖVP, SPÖ und die liberalen Neos in Wien Koalitionsgespräche platzen ließen - obwohl sie genau wussten, dass nun ein Politiker der rechtsgerichteten FPÖ im Geburtsland von Adolf Hitler Kanzler werden dürfte. Umso vehementer ist die Mahnung von Merz, aber auch CSU-Chef Markus Söder, dass dies in Deutschland nicht geschehen dürfe.
POLITIKWENDE-ZWANG
Je näher die Wahl rückt, desto mehr kann und muss sich die Union damit beschäftigen, dass sie tatsächlich ins Kanzleramt einziehen kann. Gerade weil sie so heftig gegen die Ampel-Parteien trommelte und die Rücknahme gleich mehrerer Gesetze versprach, ist die Erwartungshaltung groß, dass Merz im Falle eines Wahlsiegs die angekündigte Politikwende auch umsetzt. Mehrfach hat der Unions-Kanzlerkandidat betont, dass Parteien "am Wegesrand" stehen bleiben würden, wenn sie die von der Union ausgerufene Wende nicht mitmachen wollen. Diese bezieht Söder auf die Wirtschafts-, Migrations- und Außenpolitik. Merz schob am Sonntag hinterher, dass dazu auch die Nutzung von IP-Adressen zur Strafverfolgung gehört. Dies zielte vor allem auf die FDP und die Grünen.
"Es wäre ein Problem, wenn Merz und Söder sich jetzt sehr entschlossen geben, aber dann kein schneller Wandel kommt und die Menschen den Eindruck hätten, dass eine neue Regierung keinen Unterschied macht", warnt Politologe Lembcke. Es müsse also schnelle, klare Richtungsentscheidungen geben. Aber was geschieht, wenn die möglichen Koalitionspartner SPD und Grüne die von der Union gewünschte Radikalkur gar nicht mitmachen wollen?
Offiziell gibt man sich gelassen. Bereits zweimal witzelte der CDU-Chef, dass man den Sozialdemokraten die Autoschlüssel für Dienstwagen vor die Nase halten werde. Dann werde man sehen, wie weich die Genossen würden. Das kommt in eigenen Reihen zwar gut an - aber in der SPD heißt es dazu, dass dies nur eine Arroganz von Merz zeige, der eben nicht Angela Merkel sei. "Entweder wir gewinnen oder es könnte bei einigen der Wunsch entstehen, in die Opposition zu gehen", sagt ein führender Sozialdemokrat dazu. Ohnehin muss die Partei am Ende über einen Koalitionsvertrag abstimmen. Es ist deshalb unsicher, ob die SPD etwa eine radikale Reform des Bürgergelds mitmachen würde.
DER FLUCH DER GRÜNEN OPTION
Dazu kommt, dass die zweite Option - nämlich eine Koalition mit den Grünen - noch kritischer gesehen wird. Seit langem stichelt die AfD, dass die Union im Notfall lieber mit den Grünen als den Rechtspopulisten regieren würde. Merz hat gerade erneut bestätigt, dass es mit ihm keine Koalition mit der AfD geben werde. "Zu glauben, man könne Rechtspopulisten hoffähig machen, zur Raison bringen, zur Vernunft bringen, zum verantwortungsvollen Mitregieren veranlassen, ... das hat sich in der deutschen Geschichte schon einmal als großer Irrtum erwiesen", sagte er.
Wenn CDU und CSU mit den Grünen koalierten, dann würde dies die AfD noch stärken, warnt CSU-Chef Söder aber, der eine Koalition mit den Grünen strikt ablehnt und deren Kanzlerkandidaten Robert Habeck immer wieder massiv attackiert. Für die CSU gilt Österreich als abschreckendes Beispiel, weil die FPÖ stärkste Kraft wurde, als die ÖVP zusammen mit den Grünen regierte. Als noch größer wird die Gefahr des Verwässerns der eigenen Positionen angesehen, wenn die Union bei einem schwachen Ergebnis gleich mit zwei Koalitionspartnern regieren müsste.
APPELL AN DIE VERNUNFT DER MITTE
Und hier kommt die Zahl 2029 ins Spiel. Denn mit dem Schreckgespenst eines AfD-Wahlsiegs wollen Merz, Söder und auch Unions-Fraktionsvize Jens Spahn potenziellen Koalitionspartnern aufzeigen, dass mehr als deren Parteiinteressen auf dem Spiel steht. Mögliche Partner sollen aus staatspolitischer Verantwortung eine Politikwende mittragen. "Die Union liefert jetzt eine Variante des 'Kampfes um die Demokratie', mit dem SPD und Grüne im vergangenen Jahr die Demokratie selbst zum Wahlkampfthema gemacht hatten", sagte Politologe Lembcke. Er zweifelt allerdings, ob es klug ist, wenn CDU und teilweise die SPD jetzt selbst eine angebliche Zwangsläufigkeit der Entwicklung beschreiben. "Man könnte es auch als Eingeständnis lesen, dass die Brandmauer dann anscheinend doch nicht wirkt."
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)